| Samogon - ein gewichtiges Element russischer Lebensart | |
| Von Moskau nach Astrachan - Reisen auf der Wolga | |
| Schmuck aus Usbekistan |
Samogon - ein gewichtiges Element russischer Lebensart
Alexej Koslatschkow, freier Journalist, Moskau
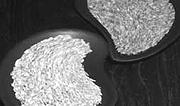
|
| Zu den wichtigsten Komponenten für die Herstellung von Samogon gehören Roggen und Gerste |
Ein nüchternes Volk ist für jede Regierung gefährlich
Der "kriminelle", gepanschte Wodka wird in der Regel wie folgt hergestellt: Ausländischer Alkohol wird mit Wasser verdünnt und kommt dann, deklariert als "echter" Wodka aus einer Brennerei, in den Handel. Selbstgebrannter dagegen wird als solcher angeboten und verkauft. Zu seiner Herstellung gehört unbedingt die Destillation in Apparaturen, die ebenfalls selbstgebastelt sind.
Was steht für den Russen noch hinter dem Begriff "Samogon"? Oft wird er als Bezeichnung für schlechten Wodka gebraucht, denn die private Produktion von hochwertigem Wodka ist ein recht schwieriges Anliegen. Zudem hat das Wort "Selbstgebrannter" immer einen Hauch von Kriminalität, denn seit es Wodka gibt - etwa seit dem 15. Jahrhundert -, war es entweder verboten, ihn privat herzustellen oder er war mit Handelsverbot belegt, und der Schwarzhandel wurde strafrechtlich verfolgt.
Auch in der Sowjetzeit war die Schwarzbrennerei verboten und wurde mit Freiheitsentzug bestraft. Das hinderte jedoch die Bevölkerung in ihrer Mehrheit nicht, vorwiegend Selbstgebrannten zu trinken. Meine Eltern beispielsweise erzählen, daß bei ihrer Hochzeit im Jahre 1959 nur Selbstgebrannter getrunken wurde. Es wurde keine einzige Flasche Wodka auf den Tisch gestellt.
Die Regierung war klug genug, den Genuß von Schwarzgebranntem geflissentlich zu übersehen. Denn Löhne, die gestattet hätten, wenigstens für die Hochzeit Wodka im Geschäft zu kaufen, konnte sie schlichtweg nicht bezahlen. Ein nüchternes und elendes Volk aber ist für jede Regierung gefährlich.

|
| Obst, beispielsweise Äpfel, Birnen, Himbeeren, Erdbeeren, findet sich in jedem russischen Haushalt |
Während der Gorbatschowschen Antialkoholkampagne war die Schwarzbrennerei real mit Freiheitsentzug verbunden. Daher wurde Gorbatschow von Alkoholikern und Abstinenzlern gleichermaßen unvorstellbar beschimpft und verdammt, wodurch sein Niedergang und seine Ablösung durch den Alkoholiker Boris Jelzin vorbereitet wurden. Ich gebe dies als kleinen Hinweis darauf, daß ein Säufer den Russen sympathischer ist als ein Moralist. Denn heute wird nur die Herstellung für den Weiterverkauf strafrechtlich verfolgt. Selbstgebrannten für den Eigenbedarf hingegen darf man in unbegrenzter Menge herstellen.
Es ist allgemein bekannt, daß Wodka für den Russen ein sehr bedeutsames Produkt ist. Wenn es keinen oder nur sehr teuren Wodka gibt beziehungsweise dieser nur unter großen Mühen zu bekommen ist, findet der Russe einen Ausweg: Er brennt ihn selbst. Selbstgebrannter ist noch mehr als der Wodka aus dem Handel Teil der russischen Lebensweise (gemeint ist nicht die Trunksucht). Wenn man Wodka kaufen will, treibt man das nötige Geld auf und - schnell, schnell geht es in ein Geschäft. Mit Selbstgebranntem hingegen sieht es anders aus: Denn man muß alles selber machen - brennen, trinken, sich vor den Behörden verstecken. Da dieses Volksanliegen unter Russen - insbesondere in schweren Zeiten - jedoch weit verbreitet ist, prägt Selbstgebrannter das russische nationale Lebensgefühl, das Bewußtsein der Bevölkerung, die Wirtschaft und - wie ersichtlich - auch die Politik.

|
| Obst, beispielsweise Äpfel, Birnen, Himbeeren, Erdbeeren, findet sich in jedem russischen Haushalt |
Nach weitverbreiteter Vorstellung ist Wodka ein in technologischer Hinsicht einfaches und daher produktionsgünstiges Produkt, das hohe Gewinne abwirft. Aber das stimmt natürlich nicht. Ein hochwertiger Wodka ist diesbezüglich mit dem Bau eines MIG-Flugzeuges vergleichbar und bricht im Hinblick auf den Arbeitsaufwand mit den modernen Vorstellungen einer rationalen Produktion. Nimmt man Einsicht in alte Wodkarezepte, versteht man, daß die Produktion dieses Getränks nur in einer Bojarenwirtschaft des mittelalterlichen Rußlands mit der praktisch unentgeltlichen Arbeit der Leibeigenen entwickelt werden konnte. Im 16. und 17. Jahrhundert wurden auf einem Adelssitz für einen Liter Qualitätswodka bis zu fünfzig Kilogramm Roggen und Weizen verbraucht. Der Zeit- und Arbeitsaufwand der Leibeigenen läßt sich hierbei nicht berechnen. Man kann somit anmerken, daß manch ein Wodkarezept aus einem alten Buch nur eine schriftliche Überlieferung bleibt.
Um diesen Sachverhalt besser zu verstehen, will ich die Herstellung von Wodka beziehungsweise Selbstgebranntem in groben Zügen veranschaulichen.
Selbstgebrannter aus einem Hocker
Hochprozentiges mit den besten Geschmackseigenschaften wird bekanntlich - zumindest unter russischen Klima- und Naturverhältnissen - aus Korn, das heißt aus Getreide hergestellt. Das Getreide läßt man zunächst zu Malz keimen. Allein die Aufzählung der einzelnen Arbeitsschritte läßt einen schwindeln. Spülen, Trocknen, Einweichen, Lüften, Mischen, Darren, Wenden, und zwar alle fünf bis sechs Stunden über einen Zeitraum von mehreren Tagen, dann wieder Spülen, Trocknen, Schälen... Bei all diesen Prozeduren bedarf es immer einer bestimmten Temperatur und Feuchtigkeit sowie einer gewissen Luftzufuhr.
Um meinen Artikel nicht auf die Größe eines populärwissenschaftlichen Buches auf-zubauschen, stelle ich das Herstellungsverfahren der Ausgangslösung - Maische - aus dem gekeimten Getreide hier nicht weiter dar. Dieser Prozeß ist noch beeindruckender. Es sei lediglich festgehalten, daß der beste Wodka aus einer Mischung von Gersten-, Roggen- und Hirsemaische im Verhältnis 2:1:1 hergestellt wird. Jede Getreidekultur wird dabei auf ihre Weise zum Keimen gebracht und vorbereitet! Erst dann werden sie gemischt.

|
| Bonbons lassen sich gut verwenden |
Selbstgebrannter ist jedoch ein so universelles Produkt wie das Leben selbst. Seine Herstellungsweise läßt sich auf die simple Addition zwei plus zwei gleich vier reduzieren. Für die Herstellung von Selbstgebranntem braucht man keine besonderen Kenntnisse. Sechs Kilogramm Zucker und 200 Gramm Hefe werden in dreißig Liter warmem Wasser aufgelöst und gut durchgerührt; für den Duft gibt man ein Bündel Dill oder Himbeerblätter zu (nicht unbedingt erforderlich); das Ganze muß dann an einem warmen Ort sechs bis sieben Tage ruhen. Nun wird dieses Vorprodukt mit Hilfe einer einfachen Vorrichtung, bestehend aus einem kleinen und einem großen Topf sowie einer Emailleschüssel, destilliert. In den größeren Topf wird die Maische gegeben. In diesem Topf wird irgendwie der kleinere Topf befestigt, und diese Konstruktion wird mit der mit kaltem Wasser gefüllten Schüssel abgedeckt. Das Unterteil der Schüssel sollte sanft gerundet sein und in den kleinen Topf passen. Die "Apparatur" wird auf das Feuer gesetzt. Im kleinen Topf sammelt sich das destillierte Fertigprodukt, das man immer wieder ausgießen muß. Im Ergebnis erhält man sechs Liter Selbstgebrannten mit einem Alkoholgehalt von etwa sechzig Prozent.
Will man nicht eine ganze Woche warten, läßt sich der Prozeß mit einem anderen Rezept auch auf einen Tag verkürzen. Fünf Kilogramm Zucker und 500 Gramm Hefe werden mit einem Liter Milch, einem Kilogramm Erbsen und fünfzehn Liter warmem Wasser gemischt. Diese Mischung 24 Stunden ziehen lassen und dann wie beschrieben destillieren. Sie erhalten fünf Liter Selbstgebrannten.

|
| Jeder andere organische Stoff, selbst ein unbehandelter Stuhl findet Verwendung |
Die Verfahren lassen sich übrigens unbegrenzt verbessern - genieren Sie sich nicht. Lassen Sie Ihre Phantasie spielen. Wir haben es mit einem weiten Feld für echte Schaffenskraft zu tun!
Ich diente seinerzeit in Afghanistan. Im Krieg ist man immer in Zeitnot. Ich denke heute noch voller Stolz daran zurück, daß dem Fallschirmjägerbataillon, dem auch ich angehörte, die Ehre zufällt, eine richtiggehende wissenschaftliche Entdeckung im Spirituosenbereich gemacht zu haben. Unsere Erfinder halbierten das kürzeste Verfahren für die Maische-Zubereitung auf eine Stunde! Ein Eisenbehälter mit den benötigten Zutaten wurde hinten an einem Panzerfahrzeug befestigt. Nach vierzig bis fünfzig Minuten Fahrt durch offenes Gelände war die Maische fertig. Man konnte sie nun brennen oder direkt trinken. Dieser "Fortschritt" wurde anschließend in ganz Afghanistan genutzt. In Friedenszeiten kann der Panzerwagen durch ein Auto ersetzt werden. Der Behälter wird im Kofferraum verstaut. Dann fährt man eine halbe Stunde auf einer nicht ganz ebenen Straße.
Selbstgebrannter weist in der Tat einen universellen Charakter auf. Die metaphorische Gegenüberstellung von Samogon und Leben ist keine Übertreibung. Die Italiener, die eigentlichen Erfinder des Wodkas, bezeichneten ihn als Aqua vitae. Diese Bezeichnung verstehe ich so: Wenn man wenigstens hundert Gramm hinunter kippt, wird man gleichsam wieder lebendig. Doch haben die Russen die italienische Erfindung dahingehend vervollkommnet, daß Selbstgebrannter buchstäblich aus jedem Stoff, zumindest pflanzlichem Stoff, hergestellt werden kann. Für die Bauern in Mittelrußland sind es in der Regel jedes Korn, Erbsen, Kartoffeln, Zuckerrüben, ein jedes Obst (in dieser Region sind es normalerweise Äpfel, Birnen und Kirschen, da es andere Obstsorten nicht gibt), Waldbeeren, Ebereschebeeren, Hagebutten, verschiedene Kräuter und sogar Fichtenzapfen. Wie oben dargelegt, wird ganz besonders hochwertiger Selbstgebrannter aus Getreide hergestellt. Doch ist dies ein ausgesprochen aufwendiges Verfahren. Viel einfacher lassen sich da Kartoffeln und Zukkerrüben verarbeiten. Selbstgebrannter Alkohol aus diesen Gemüsen ist ebenfalls hochwertig, bedarf jedoch nach der Destillation noch der Klärung. Guter Selbstgebrannter wird aus Obst gebrannt. Da in Rußland aber nur Apfelsorten mit geringem Zuckergehalt reifen, muß der Maische Zucker zugegeben werden. Diese entfällt bei reifen Ebereschebeeren, Hagebutten und Himbeeren.

|
| Die Zubereitung der Maische dauert unter Umständen viele Wochen, doch wurde durch so manche Findigkeit die Gärzeit verkürzt |
Selbstgebrannter suspekten Ursprungs wird im Volk "Taburetowka" ("Hockerwodka") genannt. Das kommt vom russischen Wort "taburetka" ("Hokker", "Schemel"), wodurch der universelle Charakter einmal mehr belegt wäre. Ostap Bender, eine Person aus dem Roman "12 Stühle" von Ilf und Petrow, versuchte, den Amerikanern das Rezept für diesen Selbstgebrannten als geheime russische Produktionstechnik zu verkaufen. Aber Spaß beiseite! Wenn es ein unversiegelter Holzschemel ist, dann ist er zur Produktion von selbstgebranntem Alkohol geeignet. Das ist natürlich allegorisch gemeint. Man müßte den Hokker zuerst zu Spänen verarbeiten, die Späne einkochen, Hefe zusetzen und nach dem bekannten Verfahren fortfahren. Anders gesagt - Selbstgebrannter ist Leben!
Die Träne von Peter I.
Ein zumutbares Getränk erfordert natürlich einen besseren Destillationsapparat als das oben beschriebene Gerät. Besonders gängig ist der Destillationsapparat der Bauart "Maxim". So hieß ein in Rußland im ersten Weltkrieg weit verbreitetes schweres Maschinengewehr, das mit einem Wasserkühlsystem ausgestattet war. Diese Technik wurde auf Destillationsapparaturen übertragen. Ich habe eine solche Apparatur von meinen Großeltern geerbt. In harten Zeiten habe ich sie natürlich auch benutzt, aber nun steht sie schon seit Jahren unbenutzt herum - eine Überlieferung volkstümlichen Lebens. Der Maischebehälter ist aus Nirostahl gefertigt und wurde von meinem Großvater in einem Unternehmen gefertigt, das Motoren für U-Boote lieferte. Nach oben geht ein Metallrohr ab, das in einer in einem Metallgehäuse installierten Spirale endet. Am Gehäuse sind nun zwei Gummischläuche befestigt. Den einen Schlauch setzt man auf den Kaltwasserhahn, aus dem anderen fließt das Wasser ab, und vom Rohrende tröpfelt der Selbstgebrannte - ein erstklassiges Erzeugnis. Man bot mir viel Geld für diese Apparatur, doch lehnte ich jedes Angebot ab. Es ist gleichsam eine Familienreliquie. Drei Generationen Koslatschkows trinken Samogon, der mittels dieses Apparats gebrannt wurde.
Destillationsapparate sind natürlich im Handel nicht erhältlich. Sie stellen immer eine originelle Entwicklungslösung des einzelnen dar. Es gibt Varianten, in denen der Selbstgebrannte bereits in dampfförmigem Zustand vom schädlichen Fuselöl geklärt wird.
Übrigens noch ein Wort zum Klärverfahren. Der hausgebrannte Alkohol - unabhängig davon, aus welchem Grundstoff er gebrannt wird - muß geklärt werden. Nach der Klärung kann man ihn mit Wasser verdünnen und ein zweites Mal destillieren. So erhält man selbstgebrannten "Doppelalkohol". Wird die Destillation drei- bis viermal vorgenommen, haben wir es mit einem ganz entzückenden Getränk zu tun, das im Volksmund "Träne" genannt wird ("tränenklar"). Dieses kann mit Kräutern und Wurzeln angesetzt werden. So verfährt aber nur ein Mensch, der sich restlos der Herstellung verschrieben hat und nur vornehmen Gästen an Festtagen ein Gläschen einschenkt. Legt man Wert auf Qualität, ist das Destillieren selbst ein komplizierter Prozeß. Die ersten fünf bis acht Prozent, der sogenannte "Erstgebrannte" (russisch: "Perwatsch"), müssen aufgrund ihres Giftgehalts weggekippt werden (manch einer bevorzugt übrigens gerade den Erstgebrannten und betrachtet ihn als echten hausgemachten Alkohol). Zum Schluß muß man verhindern, daß der trübe Rest destilliert wird, das heißt, der Prozeß muß rechtzeitig abgebrochen werden.

|
| Große Wichtigkeit kommt dem "Destillationsapparat" zu. Ein kleiner Topf wird in einem größeren befestigt. Diese Konstruktion wird mit einer mit kaltem Wasser gefüllten, nach unten gerundeten Schlüssen abgedeckt und auf den Herd gestellt. Das Fertigprodukt läuft die Außenwände der Schlüssel hinunter in den kleineren Topf |
Setzt man Selbstgebrannten mit verschiedenen Kräutern nach einem Spezialrezept an, steigt sein Preis aufgrund des Arbeitsaufwands ins Unermeßliche. Dieses Getränk erfordert Sklavenarbeit! Nachstehend das Rezept von an Anis angesetztem Selbstgebranntem, der das Lieblingsgetränk von Peter I. war.
200 Gramm Anissamen zerdrücken, mit zehn Litern geklärtem, hausgemachtem Doppelalkohol übergießen und vier Wochen ziehen lassen. Dann fünf Liter Wasser hinzugeben und destillieren. Dahinein erneut 200 Gramm zerdrückte Anissamen geben und wieder vier Wochen ziehen lassen. Abfiltern und im Verhältnis 1:3 mit weichem Quellwasser verdünnen.
Wer mit Selbstgebranntem handelt, hält sich aber natürlich nicht an solche Feinheiten, denn beim Handel steht der Gewinn im Vordergrund. Die Gewinnsucht hat Herstellungsverfahren hervorgebracht, die für die Verbraucher äußerst gesundheitsschädlich sind. Alkoholvergiftungen nach dem Genuß von irgendwo gekauftem Selbstgebranntem sind keine seltene Erscheinung. Russen machen übrigens immer einen Qualitätstest, allerdings recht eigenartiger Natur: In den Flaschenhals wird ein Finger gesteckt. Anschließend wird der Alkohol entflammt, und wenn der Finger blau brennt, ist die Qualität vertretbar.
Destillation im Gebiet Pskow
Auf dem Lande wurde stets hausgemachter Alkohol gebrannt. Ich bin überzeugt, daß sich dies fortsetzen wird, unabhängig von den politischen und wirtschaftlichen Trends. Je weniger Geld die Menschen hatten und je teurer der Wodka wurde, desto intensiver wurde schwarzgebrannt. Alkohol hatte in Rußland immer eine doppelte Zweckbestimmung. Einerseits ist da die psychologische Funktion. Puschkin sagte seiner Amme: Ein Schlückchen Wein, wo ist der Becher, das Herz wird heiter. Andererseits ist da die wirtschaftliche Funktion. Ich meine hier nicht nur die Einnahmen des Staates aus dem Wodkaverkauf. Nein, Wodka und Selbstgebrannter sind in Rußland fast immer eigenständige Zahlungsmittel. Bei Verrechnungen zwischen Bürgern wurden sie wie Geld benutzt. Zu Beginn der Perestroika, als die Geschäfte leer waren und es für Geld kaum etwas zu kaufen gab, wurden Wodka und Selbstgebrannter als Zahlungsmittel sogar bevorzugt. Im Volksmund hießen sie "nasse Dollar".
1990 und 1991 verbrachte ich den Sommer bei einem Freund in einem Dorf im Gebiet Pskow. Für eine Flasche Wodka oder Selbstgebrannten konnte man dort einen Traktoristen bestellen, um das Kartoffelfeld pflügen zu lassen. Man konnte jemanden ordern, der den Zaun oder das Dach reparierte. Die Existenzgrundlage meines Freundes war ausschließlich der Selbstgebrannte. Nicht er brannte schwarz, sondern er besorgte Selbstgebrannten im Nachbardorf bei der allseits bekannten Produzentin Oma Matrjona. Ihre Produkte waren mindestens ein Drittel billiger als der Wodka im Geschäft. Doch mein Freund kaufte den Selbstgebrannten auch nicht, sondern tauschte - es war landesweit die Zeit der "Naturalwirtschaft" - bestimmte Waren aus der Stadt wie Teekessel, Lötkolben, Glühbirnen gegen dieses Produkt. Soweit ich weiß, hat er den Selbstgebrannten nie mit Geld bezahlt. Mit diesen "Geschäften" hat er sein Hausdach erneuert, eine Sauna und andere Anlagen gebaut.
Und noch eine bemerkenswerte Geschichte aus jener Zeit. Die Firma eines Bekannten handelte in Pskow mit Spirituosen. Vor Neujahr 1993 ging der Weinhändler ein Risiko ein und orderte in Moldowa eine riesige Menge Perlwein, der schwach an Sekt erinnerte, allerdings nur einen Bruchteil kostete. Das Haltbarkeitsdatum des Perlweins lief kurz nach Neujahr ab. Nun, der Händler setzte auf das Fest und die hohen Preise für echten Sekt. Die Rechnung ging nicht auf, er wurde den Wein nicht los. Der Händler hatte aber soviel Wein gekauft, daß er vor dem Konkurs stand. So saß der Unternehmer niedergeschlagen vor seiner Lkw-Ladung Perlwein und nahm zwischendurch immer wieder einen Schluck des verdammten Weins direkt aus der Flasche.

|
| Große Wichtigkeit kommt dem "Destillationsapparat" zu. Ein kleiner Topf wird in einem größeren befestigt. Diese Konstruktion wird mit einer mit kaltem Wasser gefüllten, nach unten gerundeten Schlüssen abgedeckt und auf den Herd gestellt. Das Fertigprodukt läuft die Außenwände der Schlüssel hinunter in den kleineren Topf |
Aufschlußreich sind noch einige Besonderheiten der "Lebensweise mit Selbstgebranntem" im Gebiet Pskow, die im Prinzip für die russische Provinz charakteristisch sind. Mit der Gorbatschowschen Antialkoholkampagne wurden die Schwarzbrenner den Behörden gegenüber extrem vorsichtig. Mehr oder weniger sicher war dieses Gewerbe nur für Verwandte von Milizionären. Viele von ihnen wurden reich. Das schönste Haus des Dorfes gehört übrigens der Schwiegermutter des Ortsmilizionärs.
Die Zeiten änderten sich. Die Befürchtungen blieben jedoch. Und es blieb auch die damals entwickelte Konspiration. Kein Fremder konnte beispielsweise tagsüber im Dorf einfach Selbstgebrannten kaufen. Er mußte einen Vermittler (dieser wurde "der Behufte" genannt) finden, der sich verpflichtete, dem Kunden innerhalb einer halben Stunde die geforderte Menge zu liefern. Als Vermittlungsgebühr forderte er hundert Gramm einer jeden Flasche.
Selbstgebrannter für den Vertrieb wird übrigens in der Regel von alleinstehenden älteren Frauen hergestellt. Ein Mann in der Schwarzbrennerfamilie ist wie eine Frau auf dem Schiff - es ist das Ende des Gewerbes. Die Männer sind in erster Linie Verbraucher. Die berühmteste Schwarzbrennerin in dieser Region, Oma Matrjona, ist heute etwa fünfzig Jahre und arbeitet wie eine richtige Brennerei. Sie hat weder Mann noch Kinder. Ihr einziger Neffe ist Bauunternehmer. Da in den letzten Jahren Bargeld in den ländlichen Gebieten praktisch verschwunden ist, lieferte Matrjona einen Großteil ihrer Produkte an den Neffen, der mit dem Samogon die Bauarbeiten bezahlte. Der Selbstgebrannte wurde nicht immer getrunken, sondern oft gegen andere Produkte getauscht. Er diente real als die wichtigste Verrechnungseinheit im Rayon. Oma Matrjona funktionierte praktisch in kleinem Maßstab als Zentralbank, indem sie den "nassen Dollar" in beliebiger Menge emittierte, wobei allerdings eine Inflation bei dieser Wäh-rung nicht festgestellt wurde.
Als die Behörden in einem ihrer Anfälle der Bekämpfung der Schwarzbrennerei Matrjona mit einer Geldstrafe belegten und ihre Destillationsapparate beschlagnahmten, wußten sich die Menschen keinen Rat mehr. Die Bauarbeiten im Rayon kamen völlig zum Erliegen. Jede gesellschaftlich nützliche Tätigkeit lag brach. Dann spuckten die Behörden auf die Verbote, und die für den Rayon erquickende Tätigkeit von Oma Matrjona wurde rehabilitiert. Die Bauarbeiten wurden wieder aufgenommen.
Am Beispiel dieses Rayons im Gebiet Pskow läßt sich behaupten, daß Rußland eine jede Wirtschaftskrise überleben wird, solange dort Selbstgebrannter hergestellt wird. Auch den Zahlungsausfall wird es überstehen. Der "nasse Dollar" wird in der Krise im Unterschied zum Rubel sogar härter.
Roswitha Krebs, freie Journalistin, Heidelberg

|
| An den "grünen Haltepunkten" verlassen die Passagiere das Schiff, um ein Bad zu nehmen |
Britta Wollenweber, Redakteurin der Zeitschrift "Wostok"

|

|

|

|

|

|
Testen Sie WOSTOK unverbindlich im Probeabo!